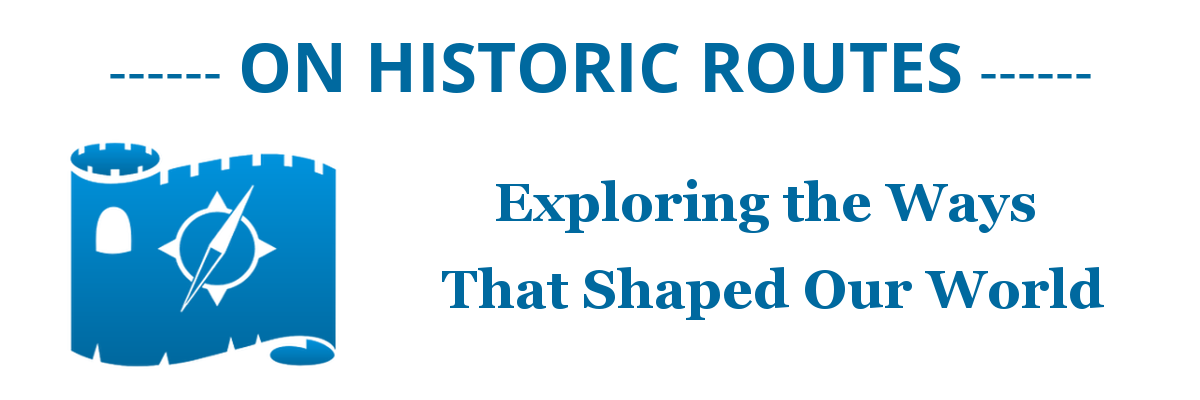Der Westfälische Hellweg
Eine Bilderreise vom Rhein an die Weser und durch 12 Jahrhunderte
Der Westfälische Hellweg zwischen Rhein und Weser war im Mittelalter die wichtigste Straße Westfalens.
Seitdem sind mehr als 1000 Jahre vergangen und die alte Naturstraße zwischen Duisburg und Höxter existiert nicht mehr.
Sie hat aber eine große Anzahl Spuren hinterlassen und der Westfälische Hellweg hat sich zu einem wichtigen Teil regionaler Identität entwickelt.
- Die Hellwegregion ist ein fest etablierter Begriff für das Gebiet der Kreise Soest und Unna sowie der Stadt Hamm. Zwischen Münster- und Sauerland, Ruhrgebiet und Ostwestfalen nimmt hier eine ganze Region Bezug auf die alte Straße und ihre Geschichte.
- Die Hauptstraßen vieler Stadtteile von Bochum und Dortmund – die oft dem Verlauf der alten Straße folgen – heißen Hellweg: Wattenscheider Hellweg, Körner Hellweg, Wickeder Hellweg usw. Sie spannen eine historische Linie durch das Ballungsgebiet aus Zeiten vor der Industralisierung.
Genug Gründe also, mehr über den historischen Hellweg zu lernen und seine Spuren zu entdecken.
Der Westfälische Hellweg – Interaktive Karte
– Kartenmarkierungen zeigen die Position der Fotos in der Galerie – Steuerelemente: Knöpfe zum zoomen und für Vollbildanzeige sind unten links – Zoom funktioniert auch durch anklicken der Karte und +/- Tasten – Kartenauswahl: Oben rechts kann zwischen der topographischen Ansicht und der klassischen OSM gewählt werden.
Der Westfälische Hellweg – Kurze Geschichte
Auch wenn die Route vermutlich ältere Ursprünge hat, markiert der Ausbau durch Karl den Großen im Zuge der Sachsenkriege (ab 772) den Beginn der Hellweg-Geschichte.
Von Duisburg zur neu gegründeten Bischofsstadt Paderborn und weiter zum Missionskloster Corvey an der Weser wurden befestigte Königshöfe im Abstand eines Tagesmarsches gebaut.
Aus diesen gingen die heutigen Hellwegstädte hervor.
Unter den ottonischen Kaisern (ca. 900-1000) war der Westfälische Hellweg Teil der regelmäßigen Königszüge zwischen Aachen und dem ottonischen Kernland nördlich des Harzes.
In den folgenden Jahrhunderten entwickelte sich der Westfälische Hellweg zu einer Handelsstraße zwischen Flandern und dem Rhein auf der einen sowie Weser, Elbe und den östlichen Teilen Deutschlands auf der anderen Seite. Alle größeren Städte am Hellweg waren damals Teil der Hanse. Mit Salz vom Hellweg und Eisenwaren aus dem Sauerland waren auch lokale Produkte Teil dieses Fernhandels.
Im frühen 19. Jahrhundert begann sich der Westfälische Hellweg grundlegend zu verändern.
Der Bau der preußischen Chaussee zwischen Paderborn und Unna verlagerte die Route weg von jahrhundertealten Naturstraße auf eine schnurgerade Route von Kirchturm zu Kirchturm, der heute noch die Bundesstraße 1 folgt.
Die Eröffnung der Eisenbahn zwischen Soest und Paderborn 1850 brachte Konkurrenz zur Straße in bisher unvorstellbarer Geschwindigkeit und Kapazität.
Schließlich transformierte die Industrialisierung des Ruhrgebiets zwischen Duisburg und Dortmund die bis dahin ebenfalls landwirtschaftliche geprägte Region in ein von Schwerindustrie geprägtes Ballungsgebiet.
Trotz und vielleicht aufgrund dieser vielfältigen Veränderungen, lässt sich heute auf dem 200 km langen Band vom Rhein an die Weser westfälische Geschichte und die Geschichte des Hellwegs entdecken.
Die interaktive Karte und die kommentierte Bildergalerie geben erste Eindrücke und laden vielleicht zur eigenen Entdeckung ein.
Westlicher Hellweg – Duisburg bis Unna
Duisburg Ruhrort
Duisburg am Rhein ist der westliche Endpunkt des Hellwegs.
Der im Mittelalter wichtige Hafen der Stadt verlandete durch eine Verschiebung des Rheins.
Im Stadtteil Ruhrort – 3 km nordwestlich des Zentrums and der Ruhrmündung – ist dafür seit dem 19. Jahrhundert der heute größte Binnenhafen Europas entstanden.
Schloß Broich
Schloß Broich in Mülheim an der Ruhr ist aus einem fränkischen Heerlager aus dem Jahr 883 hervor, als Wikinger Duisburg erobert und dort ihr Winterlager errichtet hatten.
Aus dem Lager entstand eine befestigte Burg, die hier den Übergang des Hellwegs über die Ruhr sicherte.
Der im Bild zu sehende Westflügel wurde allerdings erst 1789 fertig gestellt.
Ruhrschnellweg A40 – Essen
Im zentralen Ruhrgebiet hat die Autobahn A40 die Funktion des alten Hellwegs übernommen.
Die als Ruhrschnellweg ab 1955 gebaute Straße stellt die wichtigste und leistungsfähigste Ost-West-Straßenverbindung zwischen Duisburg und Dortmund dar.
Sie nimmt dabei einen anderen Verlauf aber in der Nähe des Essener Stadtzentrums verläuft sie auf der alten Route.
St. Reinoldi
Blick entlang des Ostenhellwegs in Dortmund auf St. Reinoldi.
Die zentrale Einkaufsstraße Dortmunds – der Westen- und Ostenhellweg führt entlang dem historischen Verlaufs des Hellwegs durch die Stadt. Im Zentrum steht die Kirche des Stadtpatrons Reinoldus. Hier querte der Hellweg den von Süden nach Norden verlaufenden Handelsweg von Köln nach Bremen.
Dortmunder Vororte
Zwischen Unna und Dortmund wurde der Hellweg nicht als peußische Chaussee ausgebaut, wie es weiter östlich geschah.
Die traditionelle Verbindung der kleinen Orte am Hellweg blieb daher erhalten und wurde ausgebaut.
Der Hellweg ist heute die Hauptstraße und Straßenbahnlinie durch die Dortmunder Vororte wie Körne, Wambel, Brackel, Asseln und Wickede.
Ölckenthurm Unna
Dieser auch Eulenturm gennante Turm war Teil der Unnaer Stadtbefestigung.
Östlich von Unna ändert sich der Charakter des Hellwegs deutlich:
Zum Einen wird dieser nun durch den Verlauf der preußischen Chaussee geprägt und zum anderen verläßt der Hellweg das stark industrialisierte Ruhrgebiet und tritt in die Soester Bördelandschaft ein.
Zentraler Hellweg – Unna bis Paderborn
Gradierwerk Werl
Das heutige Gradierwerk im Kurpark Werl dient nicht mehr der Salzproduktion, wie es die Werler Gradierwerke jahrhundertelang taten.
Werl war nicht die einzige Stadt am Hellweg, die Salz gewann. Auch in Unna, Soest, Sassendorf, Westerkotten und Salzkotten wurden salzhaltige Quellen genutzt und das Wasser daraus verdampft.
Die aufkonzentrierte Sole wurde dann in Salinen weiter verdampft und festes Salz geschöpft.
Hohlweg zwischen Werl und Soest
Oft nur wenige hundert Meter neben der Bundestraße 1 liegen heute noch Reste des alten Hellwegs.
Diese sind Nebenstraßen oder auch Feldwege und oft als Hohlweg in die Landschaft eingegraben.
Ampener Meilenstein
In Ampen bei Soest steht dieser Nachbau eines preußischen Meilensteins.
Entlang der Anfang des 19. Jahrhunderts gebauten Chaussee wiesen diese Meilensteine die Entfernungen zu den nächsten Orten aus.
Soest
Blick über den Großen Teich auf die Soester Kirchen.
Soest, im Zentrum der fruchtbaren Börde, war lange die größte Stadt Westfalens. Erst die Industrialisierung und der Aufstieg des Ruhrgebiets hat dies geändert.
Die gut erhaltene mittelalterliche Altstadt und die aus charakteristischem, grünem Sandstein gebauten Kirchen lohnen einen Besuch.
B1 bei Erwitte
Ein charakteristischer Blick auf dem Hellweg.
Die heutige Bundesstraße 1 führt schnurgerade auf den nächsten Kirchturm zu – hier auf Erwitte.
Dabei liegen rechts und links vor allem offene Felder.
Diese Wegführung geht auf den Anfang des 19. Jahrhunderts zurück, als der alte Hellweg durch eine ‘moderne’ Chaussee ersetzt wurde.
Viele der Dörfer am Weg, wie Störmede, Lohne oder Schmerlecke lagen nun abseits der Straße oder wurden nur noch gestreift.
Paderborn – Kaiserpfalz und Dom
Paderborn – ‘Quelle der Pader’ – wurde von Karl dem Großen nach den Sachsenkriegen 776 gegründet. 799 wurde das Bistum Paderborn während des historischen Besuchs Papst Leo III. gegründet.
Das Foto zeigt diese Geschichte: Vom Standort an den Paderquellen geht der Blick über die rekonstruierte Kaiserpfalz auf den Dom.
Hier am Ostende der Westfälischen Bucht und am Westrand des Eggegebirges verzweigt sich der Hellweg. Die mittelalterliche Route führt weiter nach Höxter. Die Route der preußischen Chaussee führt nach Nordosten und quest die Weser bei Hameln.
Bei Paderborn querte auch die Handelsroute Frankfurt-Bremen den Hellweg.
Östlicher Hellweg – Paderborn bis Höxter
Iburg – Peterskirche
Die Iburg übersah den Paßübergang des Hellwegs über das Eggegebirge bei Bad Driburg.
Die Iburg war eine sächsische Fluchtburg, die in den Sachsenkriegen von Karl dem Großen zerstört wurde. Auf dem Bergsporn wurde die Petruskirche errichtet und später auch eine Burganlage des Paderborner Bischofs.
Das Eggegebirge fällt hier steil nach Osten ab, so dass der Übergang vor allem zu Fuß und zu Pferd genutzt werden konnte.
Brakel Marktplatz
Brakel war die letzte Wegstation bevor der Hellweg die Weser erreichte.
Heute eine beschauliche Kleinstadt, war Brakel im Mittelalter eine weit vernetzte Hansestadt. Von dieser Zeit zeugt auch der historische Marktplatz mit dem Rathaus der Stadt.
Modexer Warte
An der Landstraße zwischen Brakel und Höxter steht dieser Turm.
Gebaut im 14. Jahrhundert war er Teil der Brakeler Landwehr.
Diese Anlage rund um die Stadt bestand aus Hecken und Türmen wie der Modexer Warte. Der Verkehr zur Stadt konnte so kontrolliert und die Stadtbevölkerung vor Überfällen gewarnt werden.
Kloster Corvey – Westwerk
Kloster Corvey liegt rund 2 km außerhalb von Höxter direkt an der Weser.
Die als Westwerk bekannte karolingische Westfassade ist Teil des UNESCO Weltkulturerbes.
Das Kloster war in der frühen Missionierung Skandinaviens aktiv.
Auch wenn die Hellweg gennante Strecke der Ost-West-Straße an der Weser endet, setzt sich diese Verbindung über Einbeck, Bad Gandersheim und am Nordrand es Harzes weiter fort. Gerade in der ottonischen Zeit war diese ‘Verlängerung des Hellwegs’ regelmäßig Teil der Königszüge z.B. nach Aachen.